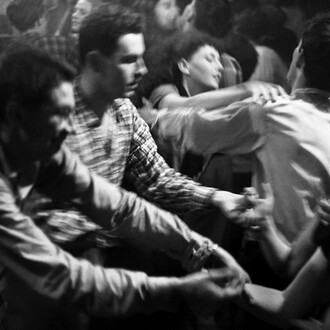Galerie Urs Meile freut sich, mit Pale world die erste Einzelausstellung des chinesischen Künstlers Chen Sixin (g.1995) in Europa zu präsentieren. Die Ausstellung vereint eine neue Werkserie, in der sich der Künstler mit der Figur des Geistes auseinandersetzt – als Symbol, das von Globalisierung geformt und durch persönliche Erinnerung, Internetkultur sowie populäre Bildwelten gefiltert wird.
In seiner neuen Werkserie aus dem Jahr 2025 greift Chen Sixin weiterhin auf das langsame, komplexe Medium der Farbstiftzeichnung zurück, wendet sich jedoch dem Motiv des „Geistes“ zu. Im Gegensatz zu den reich strukturierten, muskulösen und sehnigen Tierdarstellungen seiner früheren Arbeiten erscheinen die Geister mit unscharfen Konturen, schwebend und schwerelos über die Bildfläche gleitend. Die Leichtigkeit dieser Figuren mildert die unmittelbare, überwältigende Kraft, die viele seiner früheren Werke prägte, und öffnet Raum für Fantasie, Atem und Fluidität. Während die Tierbilder einen klaren ökologischen Bezug aufweisen, verorten sich die Geister stärker im Reich von Erinnerung und Imagination.
Im kulturellen Kontext verkörpern Geister einen „Übergangszustand“, der in unserer Lebenserfahrung oft vorkommt. Sie sind gleichzeitig lebendig und tot, furchteinflößend und faszinierend. Zahlreiche Quellen in der westlichen Kulturgeschichte befassen sich mit Geistern: In der gotischen Literatur erscheinen sie als Manifestationen ungelöster Konflikte. Mit der rasanten Entwicklung der Fotografie und dem Aufkommen der Parapsychologie im viktorianischen Zeitalter erhielten Geister eine Rolle, die teils wissenschaftlich, teils mystisch gedeutet wurde. In der zeitgenössischen Populärkultur – von niedlichen, freundlichen Geistern in Zeichentrickfilmen bis zu furchterregenden Ghulen in Horrorfilmen – vollziehen Geister einen Prozess gleichzeitiger Entzauberung und Verstärkung als Mittel für schnellen Nervenkitzel. Ihre Fähigkeit, zwischen Freundlichkeit und Einschüchterung zu wechseln, macht sie zu einem besonders beliebten Motiv in der bildenden Kunst. Auch im chinesischen Kontext ist das Bild der Geister vielschichtig: Es ist geprägt von einheimischen religiösen Vorstellungen über die Seelen der Verstorbenen und tief verwurzelt in Volksbräuchen wie dem Geisterfest (Zhongyuan-Fest), dem Grabpflegefest und weiteren traditionellen Feiertagen. Bei diesen Anlässen werden Geister häufig durch Papierpuppen, Laternen und Masken dargestellt, die auf kollektive Muster, Verwandtschaftsbeziehungen und räumliche Ordnung verweisen.
Die Geister in Chen Sixins Werken besitzen keine kulturellen Eigenschaften und dienen weder der Ermahnung noch der Einschüchterung – auch wenn der Künstler zugibt, dass der Geist in seiner Vorstellung stets „ein weißes Laken mit zwei Löchern“ war, ein Symbol, das „aus östlicher Sicht sehr westlich“ wirkt. Die Welle der Globalisierung, die das klassische Geisterbild in sein Unterbewusstsein gespült hat, beginnt bereits abzuflauen, während diese Geister – im Einklang mit den intuitiven und satirischen Elementen seines Schaffens – am Bildrand und in den Zwischenräumen der Handlung verweilen und dabei eine feine Balance aus Sentimentalität und spielerischer Leichtigkeit bewahren.
Dieses Mal konstruiert Chen Sixin die Existenz seiner Geister durch die drei räumlichen Dimensionen von Himmel, Land und Meer. Die drei neuen Werke Ghost dog, Bullet holes und Ghostly machismo (alle 2025) sind alle in Grautönen gehalten, akzentuiert durch ein Hauch von Hellgelb, und platzieren die gesichtslosen Geister scheinbar unbewusst in einem der für Tadao Ando typischen Betongebäude, in denen ein Hauch von Göttlichkeit verborgen liegt. Der Geist, der in Longing (2025) über einem blassen cyanfarbenen Hintergrund schwebt, besteht aus einer dichten Ansammlung welliger weißer Linien, während ein dünner scharlachroter Faden darauf hinweist, dass es sich um einen Drachen handelt – wenngleich wir nicht wissen, wessen Hand den Faden hält. In Shipwreck (2025) ist das Blaugrün des Meeres dichter, während der ebenfalls aus wellenförmigen weißen Linien bestehende Drache zerbrochen auf dem Boden liegt und sein Faden verschwunden ist. Ob eines dieser Werke der „Freiheit“ näherkommt, ist vielleicht nicht die Frage, die Chen Sixin stellt; der Betrachter, dessen Blick zwischen den beiden Gemälden wandert, könnte jedoch das Gefühl haben, dass Freiheit nichts anderes bedeutet, als das Gesicht eines Geistes zu besitzen.
Während zwei Werke Landschaften in der Ferne zeigen – Rot und Search search cold cold sad sad (beide 2025) – rückt Chen Sixin in No way (2025) die Perspektive näher, um einen kleinen Geist in einer Ecke aus bröckelnden Mauern zu fokussieren. Dies ist vielleicht der Moment mit dem stärksten erzählerischen Impuls in den neuen Arbeiten: Gefühle von Hilflosigkeit, sozialer Unbeholfenheit und Niedlichkeit verbinden sich hier auf besonders fesselnde Weise mit dem fragmentarischen Körper und der Haltung des Geistes.
In seinem 2014 erschienenen Buch Ghosts of my life schlägt der britische Kulturtheoretiker Mark Fisher vor, dass uns heutige Geister – anders als die Phantome der Vergangenheit – mit der „Zukunft heimsuchen, die nie eingetreten ist“. Sie erinnern beständig an historische Möglichkeiten, die ausgesetzt oder verschwunden sind, und hinterlassen bleibende Echos ihrer „Abwesenheit“. Dieses „Geistergefühl“ ist besonders ausgeprägt in einer Nachkriegszeit, die von kontinuierlichem technologischem Fortschritt geprägt ist, und in einer Kultur, die stark von Nostalgie durchdrungen ist. Vor diesem Hintergrund ist die „spektrologische Wende“ in Chen Sixins Werk nicht nur eine formale Entscheidung, sondern zugleich ein subtiler Reflex auf einen spezifischen Zeitgeist. Der Künstler selbst betont, dass sein Interesse am Zeichnen von Geistern aus einer Fülle von Internetvideos herrührt. Dieses „Internet-Grazing“ ist möglicherweise die größte Gemeinsamkeit der heutigen Jugend. Während der Liberalismus erodiert und sich die Post-Pandemie-Normalität verfestigt, fluten Videos von Krieg, Katastrophen, Haustieren und Comedy unsere Bildschirme. Die Mischung aus fernen Todesszenen und alltäglicher Unterhaltung hat den schwebenden, durchscheinenden, flüchtigen Geist näher an unsere alltägliche Welterfahrung gebracht – eine Erfahrung ständiger Unsicherheit und Spannung. Diese kreative Wende könnte zugleich ein Echo von Chen Sixins eigener Identitätsverschiebung in Zeiten wirtschaftlicher Rezession und sinkender gesellschaftlicher Moral sein. Kunst ist heute vielleicht nicht mehr der eindeutige Träger von Marktbegeisterung und ästhetischem Fortschritt, der sie einst war. Stattdessen muss sie sich, zumindest vorübergehend, mit einer „Herabstufung der Mission“ auseinandersetzen und als eine Art Container für fließende Gefühle fungieren.
(Auszug aus dem Essay „Chen Sixin: The tail of the story“, von Ren Yue)