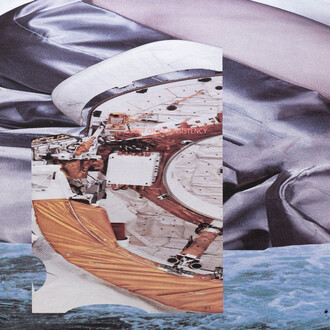Es gibt Geschmäcker, die sich in die Erinnerung fräsen; das herbe Süß, zum Beispiel, von Blutorangensaft, getrunken an einem Sommermorgen 2017, wenn der Tag noch nichts verlangt. Ein heißer Sommer, durchzogen von Cartoons, Cornflakes, Langeweile, Computerspielen im abgedunkelten Zimmer und eben diesem Geschmack der Blutorange. Da war Zeit, um zu Lungern im besten Sinne, eine Zeit zwischen Abschluss und Aufbruch, zwischen Danach und Davor.
Aelita le Quément malt aus dieser Zwischenzeit heraus. Ihre Bilder erzählen von Menschen, die irgendwie am Rand von etwas sitzen: der Straße, der Entscheidung, der eigenen Geschichte. In le Quéments Welt ist nichts statisch, alles in Bewegung, alles im Übergang. Orte des Transits, Tankstellen, Wartezimmer, Kioske, werden zu Szenerien der Existenz, in denen wir uns, scheinbar beiläufig, selbst begegnen.
Doch bevor le Quément ihre Geschichten erzählen konnte, musste sie einen anderen Weg zum Ausdruck finden. Sie wuchs als stilles Kind auf, in einem Körper, dessen Sprache sie nicht kannte, eine frühe Diagnose von Dysphasie, eine neurologisch bedingte Sprachentwicklungsstörung, machte Worte zu Hindernissen. Kommunikation wurde zur Baustelle, Satz für Satz, Silbe für Silbe. In dieser lautlosen Zwischenzeit war das Zeichnen eine Brücke, Illustration die Sprache; was die Zunge nicht sagen konnte, erzählte die Hand.
Eine therapeutische Notwendigkeit ebnete den künstlerischen Weg. Die Linie wurde Form, der Strich wurde Gefühl. In der Schule, als die Fragen nach Identität an Kraft gewannen, wurde das Zeichnen zum Rückzugsort; ein geschütztes Nest, ein stiller Kontrollraum. Aelita le Quément, die damals noch einen anderen Namen trug, begann, sich selbst zu entwerfen.
Sie wuchs auf in einem Umfeld, das liberal war, aber nicht wissend. Queerness, Transsein, das Andersfühlen: All das blieb lange namenlos. Erst mit Filmen wie Paris is burning, mit neu geschlossenen Freundschaften, Romanzen und damit einhergehenden Gesprächen über Menschlichkeit, ja, Fehlerhaftigkeit begann der Prozess der Selbstwerdung. Aus einer Geschichte des Schweigens wurde eine des Sprechens, nicht nur mit Worten, doch mit Bildern. In dieser Zeit erkannte sie etwas Grundlegendes, nämlich, dass Menschen nicht deshalb verletzen, weil sie schlecht sind, sondern weil sie selbst verletzt wurden. Dass Unvollkommenheit kein Makel ist, sondern eine notwendige Spur des Menschseins. Diese Erkenntnis markiert einen Wendepunkt: den Versuch, mit der Vergangenheit Frieden zu schließen und die Entscheidung, sich selbst einen neuen Namen zu geben. »Aelita« wird zur Figur der Selbstermächtigung, zur Geste der Kontrolle über das eigene Leben.
Die Ausstellung Blutorange ist durchzogen von dieser persönlichen wie kollektiven Bewegung, vom Suchen, vom Warten, ja, vom einander Begegnen und dem Finden. Zwei Räume strukturieren die Erzählung, zwei seelische Landschaften, zwei Blickrichtungen: der Blick nach außen und der nach innen.
Der erste Raum, Gas station, wirft den Blick nach außen; auf das Unterwegssein, auf den Ort dazwischen, Alien-Orte, Grenzorte, liminale Räume. Le Quément verwandelt funktionale Orte in soziale Kulissen. Eine Tankstelle wird hier zur temporären Heimat; ein Treffpunkt nach der Schicht, vor dem Club, zwischen dem Jetzt und dem Danach; dabei geht es nicht um den Zweck des Tankens, sondern um seine Verfremdung, das Zusammensein, das gemeinschaftliche Existieren. Die großformatigen Gemälde zeigen Außen- und Innenräume, die ineinandergreifen: Verkaufsregale voller Alltagsobjekte, Neonlicht auf Haut, Gespräche zwischen den Türen und Angeln. Wer den Raum betritt, steht selbst im Grenzort, dem Transit, der Räume, dem Dazwischen, nimmt Teil an den Szenerien der Werke. Drei großformatige Gemälde bilden das Herzstück: ein Triptychon des Ausharrens.
Im Raum Cartoons and cereals wird der Blick introspektiv, die Erinnerung an das kindliche Zimmer, in dem der Fernseher flimmert, Cartoonrauschen, und draußen die Welt wartet. Innenleben, Kindheit, Verlust, Verwandlung, Erinnerungen an französische Animes und morgendliche Cornflakes-Schalen werden zu Trägern einer tiefhängenden Melancholie. Die weichen Formen, die an Looney-Tunes-Figuren erinnern, das Bunte mögen naiv scheinen, doch sie täuschen nicht über das Gefühl von Leere hinweg, sind getragen von Brüchen, Einsamkeit, Flucht, Stille, Verlust. Ihre Figuren sind oft nur von hinten zu sehen, die Gesichter unsichtbar, abgewandt, aber in ihrem Rücken, in ihrer Haltung, in der Richtung ihres Blicks, liegt ein ganzes Drama. Le Quément malt diese Spannung, zwischen Trost und Trauma, Licht und Dunkel, dem Bedürfnis nach Nähe und dem Rückzug ins eigene Selbst.
Le Quéments Stil ist organisch, ungeschliffen, lebendig, sie arbeitet mit Acryl auf Papier und Leinwand, malt mit den Fingern, skizziert digital, nutzt Photoshop-Collagen als Rohmaterial. Nichts ist perfektioniert; alles ist gemeint. Gleich den Menschen, denen sie begegnet und die sie malt, skizziert, werden Fehler nicht verborgen, sondern eingeladen und als Teil des Ganzen betrachtet. Im Prozess des Malens werden sie zu Zeitgenossen, zu Partner*innen, zu freundschaftlichen Begegnungen, Geschichten, Andeutungen, Szenerien, strudelartig umrissen, wie in sich selbst verknotet, flackernd und poetisch. Ohne Nostalgie aber, kein Rückblick, keine Wehmut ist da, sondern ein einfaches, hörbares, chaotisches, ehrliches Gefühl und die Erkenntnis: Fehler sind keine Schwächen, sondern Spuren.
Begleitet wird die Ausstellung von Panty Paradise, dem Duo mit Veronica Burnuthian, das fragmentierte Klanglandschaften aus elektronischen, verzerrten und verrauschten Sounds erschafft und dabei Ambient, Electronic Glitch, Resamples und Spoken Word vereint. Es ist der Sound einer Zeit, die nie ganz vorbei ist, sondern sich in Farbe, Ton, Erinnerung fortsetzt.
Aelita le Quément malt, um sich zu erinnern, um zu erzählen, was schwer zu sagen ist, um Räume zu schaffen, in denen andere sich wiederfinden können; zwischen Licht und Schatten, Kindheit und Gegenwart, Farbe und Schweigen.
(Text von Amelie Kahl)